Die Welt in meinen Augen (2): Der Schriftsteller Peter Mannsdorff über Bipolare Störungen.
Menschen mit Erkrankungen aus dem bipolaren Spektrum – früher noch als „manisch-depressiv“ bezeichnet – werden nach wie vor stigmatisiert. Weltweit beträgt die Prävalenz bipolarer Störungen durchschnittlich 3%(1). Viele wissen nicht: Betroffene sind weit mehr als von „himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt“.
Im diesem zweiten Teil haben wir den Schriftsteller Peter Mannsdorff befragt, der uns Anfang November 2018 für ein Interview zur Verfügung stand.
Beschreibe uns einen typischen Tag (24 Stunden) in deinem Leben, an dem du mit deinen Symptomen zu kämpfen hattest. Beschreibe bitte dabei, was du erlebt und gefühlt hast. Was hat dazu beigetragen, dass dieser Tag kein guter war? Was hat oder hätte dir geholfen, diesen Tag besser zu überstehen? Lass uns einen solchen Tag durch deine Augen sehen!
Ein guter oder schlechter Tag – das kann ich nur durch meine eigene subjektive Wahrnehmung beschreiben. Ein echt schlechter Tag wäre eine Depression, aber die hatte ich seit über fünfzehn Jahren nicht mehr, und wenn sich eine Manie anbahnt, ist das zwar subjektiv ein guter Tag, objektiv aber ein schlechter. Das totale Glücksgefühl während meiner Manien erlebe ich ja nicht im negativen Sinne. Aber ich weiß, dass ich mich dann auf einem gefährlichen Terrain bewege, wenn ich im Begriff bin, manisch zu werden oder mich bereits in der Manie befinde – auch beim Schreiben. Musik fließt wie ein Südwind durch meine Seele, wie Gesänge. Es ist, als ob ich durch ein Schlüsselloch gucke: ich nenne es das Gucken durch ein Schlüsselloch in das „dreizehnte Zimmer“ – in dieses Zimmer darf ich eigentlich nicht sehen, denn dort liegen Schlüsselerlebnisse der Vergangenheit, die mich immer wieder in eine Spirale zwischen Schmerz und Glücksgefühl bringen.
Eins muss man wissen: Jede Manie ist eine versteckte Depression, zu vergleichen mit einem Atomkraftwerk. Außen ist eine Mauer aus Beton, aber innen strahlt der Atomkern, immer und gefährlich. Die Betonmauer ist von außen angemalt mit bunten Farben, sie sind fratzenhaft, während innen die Depression weiter lauert.
Meine Frau kennt die Gefühle aus dieser Welt, in der ich mich dann befinde. Im drohenden schlimmsten Fall überredet sie mich dann, mich in die Klinik zu begleiten, um spätere Flurschäden zu vermeiden und bevor sich weitere Katastrophen ereignen durch eine Manie. Sie hat ebenso Frühwarnsysteme entwickelt und übernimmt dann die Beschützerfunktion. Ich selbst erlebe ja in den Manien nicht, dass dies ein schlechter Tag für mich ist, der weitere mit sich bringt, um dann – wie die meisten Maniker – unvermeidlich in die Depression zu stürzen. Auslösende Katastrophen, die mich nicht selten in eine Krise stürzen, sind Tod, Krankheit; Verluste bringen meine Orientierung, meine Verortung durcheinander.
Beschreibe uns einen typischen Tag in deinem Leben, den du genießen kannst, an dem du zufrieden bist. Beschreibe bitte dabei, was du erlebt und gefühlt hast. Was hat diesen Tag zu einem guten gemacht? Wer oder was hat dazu beigetragen?
An einem guten Tag stehe ich wie immer vor meiner Frau auf, ich lese oder arbeite am Computer. Später gehe ich zu meiner Arbeitsstelle, einer Literaturgruppe (zweimal die Woche) in Berlin, dort diskutieren wir Texte und genießen anschließend ein geselliges Zusammensein mit den Kollegen. Danach besuche ich meinen Vater im Pflegeheim hier in der Nähe. Er ist ein 96 Jahre alt, bettlägrig, aber er hält seine Situation tapfer aus; ich habe mich inzwischen mit ihm versöhnt. Ich glaube, er hat durch seine Erziehung einiges zu meiner Krankheit dazu getan. Schwamm drüber! Danach gehe ich in ein alternatives Café, trinke dort einen Cappuccino treffe mich mit Freunden; zu Hause dann arbeite ich wieder über meinen Texten. Oft fahren meine Frau und ich zu Lesungen nach Magdeburg oder Eisenach etc. Anschließend gehen wir essen und gucken uns, wenn Zeit bleibt, die Stadt an.
Dies sind Tage, an denen ich mich wohl fühle – und meine Frau auch. Da fühle ich mich im inneren Gleichgewicht, fernab von ‚schrägen’ Ideen.
Psychische Störungen, wie z.B. Erkrankungen aus dem bipolaren Spektrum, rufen in der Gesellschaft immer noch Vorurteile hervor, die sich auch in der Sprache zeigen. (Zeitweise) betroffene Menschen werden dann als „verrückt“ bezeichnet. Wie kannst du – aus eigener Erfahrung oder jenen deines persönlichen Umfeldes – diesen Vorurteilen entgegenwirken?
Meine Mutter sprach oft über die Leute meiner ‚Szene’ als die ‚Bekloppten’. Ich nahm ihr das nie übel. Vielleicht habe ich ihren Humor geerbt, er spiegelt sich auch, sagt man, in meinen Büchern wider. Jedenfalls kann ich so auch über mich lachen. Bei Fremden oder anderen Menschen reagiere ich dann allerdings natürlich sehr sensibel.
Ein wichtiges Problem ist dabei natürlich das des ‚Outens’. Es stellt sich immer die Frage, wem gegenüber ich mich „oute“ und wem nicht. In meiner beruflichen Tätigkeit als Autor bekenne ich mich dazu, dass ich eben auch Psychiatrieerfahrener bin. Wobei in Schulen und Bibliotheken muss nicht jeder wissen, in welchem Nest ich zwitschere.
Was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft (Medien, Institutionen, am Stammtisch), wie mit Betroffenen von Bipolaren Störungen umgegangen werden soll und wie diese Menschen wahrgenommen werden sollten?
In den Medien muss sachlicher und ausführlicher aufgeklärt werden. Menschen, die Straftaten begangen haben (wie beispielsweise einen Mord), kommen in eine forensische Unterbringung, nicht in eine allgemein psychiatrische. Hier werden oft genug noch Straftäter mit psychisch Kranken in einen Topf geworfen. Das darf nicht sein, denn es kann dazu führen, dass mein Nachbar denkt, der Mannsdorff ist ein Krimineller, wenn er in der Klinik ist.
Grundsätzlich muss einfach mehr über die Erkrankung aufgeklärt werden.
Vielleicht auch ein wenig mehr Gelassenheit. Ich nenne ein Beispiel, das ich paradoxe Intervention nenne:
Ich hatte einmal während einer Manie den Fimmel, selber eine Zeitung herauszugeben (eins meiner Schlüsselerlebnisse), um sie in ganz Berlin zu verteilen und Berlin zu revolutionieren. Meine Frau sagte: „Tolle Idee, das machen wir.“ Nächste Woche wieder: „Wann machen wir’s?“ „Noch nicht.“ Als ich wieder gelandet war. Sie: „Jetzt?“ Ich: „Nö: Keine Lust mehr.“ Ich war wieder gesund. Sie holte mich auf den Boden der Realität zurück, indem sie auf meine Ebene einging, mir aber nicht den Größenwahnsinn vorhielt. Sie schraubte mich spielerisch wieder herunter mit ironischer Distanz. Mein Vater reagierte damals falsch: verbissen wollte er mich in die Realität zurückholen, und erzeugte damit nur mehr Widerstand meinerseits.
Als Schriftsteller schreibst Du gegen die Stigmatisierung an im Bereich Jugendbuch („Party im Kopf“). Neben der tragischen Hintergrundgeschichte gibt es aber auch viel Anlass, lachen oder schmunzeln zu dürfen. Glaubst du, dass Humor dazu beiträgt, besser zu verstehen, sich darauf einzulassen, und hat Humor dann auch eine Entlastungsfunktion?
Mit Humor kann man Wahrheiten besser ergründen. Ich bin der Überzeugung, durch Humor erfasst der Leser die unterschwellige Tragik des Geschehens besser. Das Buch „Jakob der Lügner“ von Jurek Becker war ein großes Vorbild für mich. Der Leser weiß, dass alle jüdischen Protagonisten im Ghetto am Ende umgebracht werden, trotzdem kann er über ihre kleinen Schrullen lachen. Ich finde, dass ich als betroffener Autor das Recht habe, meine Leser über das manisches Verhalten des Vaters von Robbi auch zum Lachen zu bringen, ohne dass sie ihn auslachen.
Wie denkst Du darüber – kann eine psychische Erkrankung jeden treffen?
Als Beantwortung dieser Frage möchte ich eine Passage aus ‚Party im Kopf’ zitieren:
„Schwester Edel … bekomme ich … na … Sie verstehen schon!“
Schwester Edel lacht: „Gar nichts verstehe ich. Los, raus mit der Sprache!“
„Na gut, kann ich Papas Krankheit auch mal bekommen?“
„Oh je oh je!“ Schwester Edel lacht nicht mehr. „Du stellst Fragen. Mach dir darüber mal nicht so viele Gedanken. Du bist ein Kind, hast dein Leben noch vor dir. Sieh mal, jeder kann so eine manisch-depressive Krankheit bekommen. Ich, deine Großmutter, sogar die Ärztin deines Vaters oder Herr Üdycin. Davor ist keiner geschützt. Aber in der Regel kommt das selten vor. Und Vererbung? Gut, das kann vorkommen … aber weißt du, es sind wohl doch mehr die äußeren Umstände, die Menschen krank werden lassen, die Erlebnisse, die der einzelne hat, wie er damit umgeht und so… aber jetzt ab zu deinem Vati. Er wartet schon! Muntere ihn ein wenig auf, er wird sich freuen.“
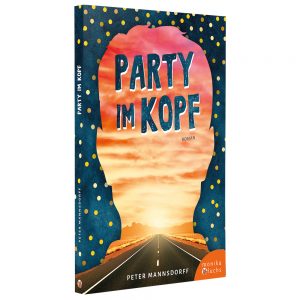
Der Schriftsteller Peter Mannsdorff (Jahrgang 1957) schreibt seit über 30 Jahren Kinder- und Erwachsenenliteratur. Eines seiner Anliegen ist es, das Leben psychisch Kranker sichtbar zu machen: er schreibt gegen Vorurteile und Stigmatisierung an. Aber auch die Angehörigen verliert Peter Mannsdorff nicht aus dem Blick – in »Party im Kopf« stellt er die Schwierigkeiten dar, mit denen Kinder manisch-depressiver Eltern zu kämpfen haben. „Party im Kopf“ ist 2018 im Verlag Monika Fuchs erschienen.
An dieser Stelle danke ich Herrn Mannsdorff für das erfrischende und schöne Gespräch, das ich Anfang November mit ihm führen durfte. Tina Meffert.



